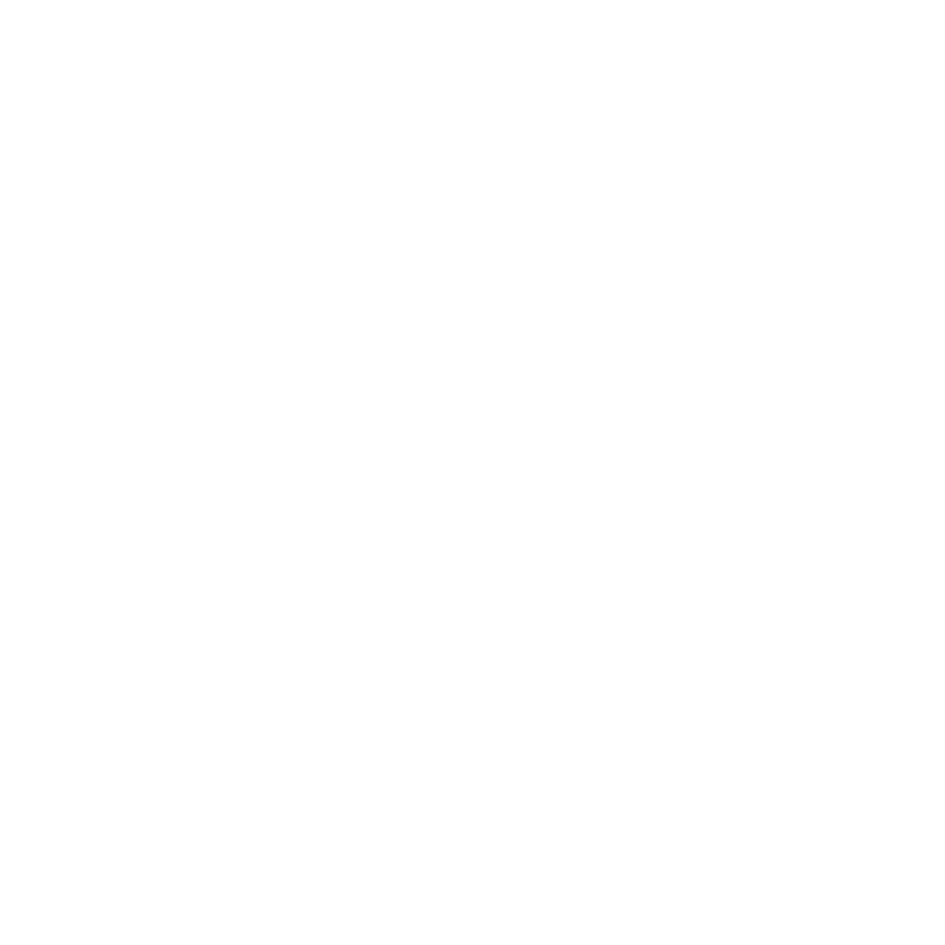Junge Männer finden ihren Platz in der Welt nicht leicht. Fernweh, Weltschmerz und gnadenloser Wettbewerb stellen sich ihnen zwangsläufig in den Weg. Zwar lieben sie durchaus die gerechte Sache, allerdings nicht etwa deshalb, weil sie gerecht ist, sondern wegen der glitzernden Glut, der „brennenden Lunte“. Das erkannte Nietzsche und setzte hinzu: „Mit Gründen gewinnt man diese Pulverfässer nicht!“
Professor Jordan Peterson hat sie aber gewonnen, und zwar mit guten Gründen. Die brennende Lunte ist dabei die Sache seiner Gegner, die ihn am liebsten von seinem Heimatcampus in Toronto verjagen würden, seitdem er dort ankündigte, sich gesetzlich vorgeschriebener Gendersprache verweigern zu wollen. Zumindest in den oft absurden Filterblasen, die im Westen schon länger (und noch immer) als geisteswissenschaftliche Fakultäten durchgehen, reicht so etwas aus, um sich mächtige Feinde zu machen.
In ihren Augen hat Peterson sich schlicht in der Zeit geirrt. Gut hätte er ins 18. Jahrhundert gepasst, als die aufgeklärten Wissenschaften sich noch so hervorragend mit einem traditionalistischen Weltbild vertrugen – als selbst der rebellisch-kantige Thomas Jefferson seine entstehende Nation auf die „Gesetze der Natur und des Gottes der Natur“ einschwor. Zu einer Zeit also, als man zwar selbstbewusst genug war, sich dem Vorbild der Antike überlegen zu glauben, aber gleichzeitig auch bescheiden genug, sich ob des Vergleichs geschmeichelt zu fühlen.
Für Petersons Kritiker wäre er wohl schon dem 19. Jahrhundert nicht mehr zumutbar gewesen – immerhin die Ära von Karl Marx und seiner zukunftsgewandten (Zeit-) Genossen. Der Deutschlandfunk zum Beispiel überschrieb einen Artikel über den adretten Kanadier unlängst mit einer Beschreibung, die wohl als Urteilsspruch verstanden werden muss: „Gegen die moderne Welt“. Hier befindet Peterson sich allerdings in bester Gesellschaft, etwa der von Leo Strauss, von dem Wikipedia behauptet, er gelte „als Kritiker der modernen Philosophie sowie des modernen liberalen Denkens überhaupt“. Na dann.
Linksliberale "Chaoten" werden gebraucht
Reaktionär wirkt Peterson tatsächlich – allerdings lediglich auf jene, die die Geschichte ausschließlich durch das Prisma der eigenen Zeit zu betrachten verstehen. Er ist in Wahrheit das beste Beispiel dafür, dass auch das Gegenteil möglich ist, nämlich die kritische Beurteilung der eigenen Epoche mit all ihren Vorurteilen und Unzulänglichkeiten unter Zuhilfenahme der gebündelten Weisheit vergangener Zeiten. Und genau auf diese Weise ist ihm mit dem Verkaufsschlager12 Rules for Life: An Antidote to Chaos, der Ende Oktober in deutscher Übersetzung erscheint, ein echtes Meisterstück gelungen.
Seine philosophischen Grundlagen erläutert Peterson bereits in der Einleitung, in der er auch den Bogen zu seinem wissenschaftlichen Opus Magnum Maps of Meaning spannt (welches er einst auf seiner Website zum freien Download anbot und zwar nicht trotz, sondern gerade wegen des prohibitiven Preises. Vermutlich hat der Verleger sich mittlerweile über diese großherzige Geste beschwert, jedenfalls ist der Link nicht mehr auffindbar).
Sein wichtigster theoretischer Schlüssel zur Dechiffrierung der menschlichen Wertewelt ist dabei ihre Aufteilung in ein bipolares Muster aus Ordnung auf der einen und Chaos auf der anderen Seite. Er begibt sich auf die Suche nach der Geburt der Sinnstiftung aus dem Geiste der Dichotomie. Widergespiegelt wird diese, so Peterson, in fast allen wichtigen psychologischen Bedeutungspaaren: Ordnung ist männlich, konservativ, königlich wie tyrannisch; Chaos hingegen ist weiblich, innovativ, zugleich schöpferisch und potenziell zerstörerisch. Kein Wunder also, dass er dem taoistischen Symbol des Yin und Yang zugeneigt ist.
In dieser Unterscheidung liegt gleichzeitig eine große Hoffnung begründet. Denn durch sie lässt sich auch die politische Geometrie ein Stück weit entwirren. Peterson geht Extremismus grundsätzlich aus dem Weg, aber ebenso pocht er darauf, dass die der Ordnung zugewandte Rechte und die veränderungsaffine Linke in ihrer psychologischen Legitimation einander ebenbürtig sind. Mehr noch, beide sind absolut notwendig. Wer strukturbetont ist, profitiert von der Zusammenarbeit mit Kreativen. Ebenso braucht der rastlose Innovator gewissenhafte Konservative, die für ihn den Laden tagtäglich zusammenhalten. Aus diesem Grund wäre es erfreulich, wenn auch viele linksliberale „Chaoten“ Petersons Buch lesen, denn sie haben ihren festen Platz in seinem Kosmos, besitzen ihre Rechtfertigung und werden gebraucht.
Für Peterson wird der Ritt durch die Hölle nie zum Selbstzweck
Als Konservativer musste ich bei der Lektüre an ein Zitat aus Moby Dick denken, das die stürmische Geisteshaltung der modernen Linken in einem fast schon beneidenswerten Glanze erscheinen lässt: „Was mich betrifft, so bin ich gequält von einem ewigen Jucken nach entfernten Dingen. Ich liebe es, auf verbotenen Meeren zu segeln“. Wenn es nicht auch solche Leute gebe, müsste man sie erfinden – nur wer wüsste dann noch, wie?
Selbst wenn Peterson in 12 Rules for Life versuchte, den eigenen Konservatismus zu verstecken, wäre es nicht schwer, ihn zwischen den Zeilen herauszulesen. Er nennt sein Buch ein Gegengift für das Chaos. Nicht, dass er leugnen würde, dass auch das Chaos seine Vorteile hat – in einem Buch mit so vielen Nietzsche-Zitaten ist es eher verwunderlich, dass ein wichtiges fehlt, nämlich: „Man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können“ – aber für Peterson wird der Ritt durch die Hölle nie zum Selbstzweck.
Jeder Abstieg in die Unterwelt, jedes Bad im reinigenden Feuer muss sein Ende finden, um der Geburt einer besseren Welt dienlich zu sein. Täglich, wenn es sein muss, ja, aber immer mit der Ziellinie im Blick. Ohne Ordnung geht es nicht, denn jeder Mensch hat ein natürliches Bedürfnis nach einem bedeutungsvollen Leben, nach Werten und sogar Hierarchie. Im Chaos verlieren sich auf Dauer auch die hartgesottensten Nietzscheaner. Deren Projekt der selbstgebundenen Wertgebung ist schlicht unmöglich. Also lieber Dostojewski und die aufgeklärte Suche nach Gott (den Peterson übrigens niemandem aufzwingt. Er ist Christ, aber – möchte man fast hinzusetzen – er ist eben auch Kanadier).
So verwundert es nicht, wenn Peterson in aller Deutlichkeit die Vorteile einer tradierten, homogenen Ordnung beschreibt – und was auf dem Spiel steht, wenn wir sie verlieren: „Menschen, die nach derselben Norm leben, werden dadurch einander vorhersehbar […] Menschen, die wissen, was sie voneinander zu erwarten haben, können zusammenarbeiten, um die Welt zu zähmen. Es gibt vielleicht nichts Wichtigeres als die Aufrechterhaltung dieser Ordnung – dieser Vereinfachung. Wenn sie bedroht ist, schwankt das Schiff des Staates. […] Im Westen haben wir uns von unseren traditionell, religiös und national begründeten Kulturen zurückgezogen, zum Teil, um die Gefahr von Gruppenkonflikten zu verringern. Aber wir werden zunehmend zu Opfern einer Verzweiflung der Bedeutungslosigkeit, und das ist wirklich nicht besser.” Das möchte man so manchem Politiker gern ins Stammbuch schreiben, nicht zuletzt auch jener Kapitänin, die das Schiff des Staates ins Chaos zu lenken droht und dabei auch noch dreist unter falscher Flagge – und zwar ausgerechnet der der Ordnung – segelt.
Feuerlöscher für den kulturellen Großbrand
Die große Überzeugungskraft von Petersons praktischen Ratschlägen erwächst auch aus seiner frommen (und angemessenen) Bescheidenheit gegenüber der kulturellen Erbschaft, die wir als Treuhänder der westlichen Zivilisation angetreten sind. Haben wir sie uns überhaupt verdient? Wie kämen wir zu so einem Gedanken? Als deutscher Leser möchte man direkt ein Zitat aus Goethes Faust einschieben: „Was du ererbt von deinen Vätern hast / Erwirb es, um es zu besitzen“. Wer sich der Vorteile eines Erbes bedient, muss sich der Vererbenden als würdig erweisen. Da gibt es keine Rosinenpickerei, nicht in Richtung morgen und erst recht nicht in Richtung gestern.
Genau an dem Punkt hapert es aber – heute. Hat denn selbst die zeugende Generation das Recht, die Nachwelt ihrer Vorfahren zu berauben? Hat nicht schon Aristoteles angemahnt, ein Vater könne seinen Sohn verstoßen, aber niemals umgekehrt, hat doch der Vater mehr für den Sohn getan, als dieser jemals zurückzahlen könnte? Thomas Jefferson hat sich von solchen Fragen durchaus unbeeindruckt gezeigt („Die Erde gehört den Lebenden“ ), aber für Peterson ist die Lage verzwickter. Er steht eindeutig auf der Seite des nicht weniger genialen Edmund Burke, welcher politische Abstraktionen wie Jeffersons Naturrecht für gefährlich hielt und für den jeder echte Gesellschaftsvertrag eine Partnerschaft zwischen den Toten, den Lebendigen und den Ungeborenen bedeutete.
Obwohl weder Jefferson noch Burke in Petersons Werk explizit vorkommen, sind doch beide bei der Lektüre präsent. Selten hat es zwischen zwei Denkern mit einem ähnlichen kulturellen Hintergrund, vergleichbarer Bildung und Begabung solche Unterschiede in politischen Fragen gegeben. Aber Jefferson lebte auf einem „frischen“ Kontinent voller Optimismus, in einem Land, zu dessen Gründung er mehr beitrug als fast jeder andere, dessen Grenzen er als Präsident zudem noch eigenhändig mit dem Kauf des gigantischen Louisiana-Territoriums explosiv vergrößerte.
Burke hingegen war Herzblutbrite und wollte niemals etwas anderes sein als das. Und er hatte Grund für seinen Pessimismus, sah er doch mit eigenen Augen die fanatische Selbstzerfleischung der französischen Revolution und das durch sie vergossene Blut und verspritzte Gift. Seine Umstände sind deshalb näher an denen von Professor Peterson, der ja in den postmodernen Universitäten längst auch einen Fanatismus zu erkennen glaubt – einen unblutigen, aber wahrlich keinen ungiftigen. Und die Diagnose des klinischen Psychologen erfordert aktuell die Handbremse nach Burke, nicht die Revolution nach Jefferson. Deshalb ist Petersons Ruf nach vergangenen Zeiten so zeitgemäß. Er ist der Feuerlöscher für den kulturellen Großbrand.
Wir laufen unbewusst auf dünnem Eis
Die Brandstifter derweil haben keine Geduld für solche Feinsinnigkeiten. Sie lechzen nach politischen Umwälzungen, ohne überhaupt den intellektuellen Ausgangspunkt zu würdigen, von dem aus sie ihre überstürzten Feldzüge starten. Sie glauben an die Bedingungslosigkeit des modernen Westens. Peterson schreibt: „Wir haben zusammenzuleben und unsere komplexen Gesellschaften zu organisieren gelernt – langsam und schrittweise, über große Zeiträume hinweg – und wir verstehen nicht ausreichend gut, warum das, was wir tun, funktioniert. Unser soziales Dasein fahrlässig im Namen irgendeines ideologischen Slogans (Vielfalt als ein Beispiel) zu ändern, bringt mit großer Wahrscheinlichkeit viel mehr Schlechtes als Gutes – in Anbetracht des Leids, das selbst kleine Revolutionen produzieren. […] Horror und Furcht lauern hinter den Mauern, die unsere Vorfahren so weise errichtet haben. Wir reißen sie zu unserer eigenen Gefahr nieder. Wir laufen unbewusst auf dünnem Eis, mit tiefem, kaltem Wasser unter uns, wo unvorstellbare Monster sich herumtreiben“.
Mit den ordnenden Mauern der Vorfahren gegen die grenzenlos-chaotische Welt der Ideologen. Und wer soll das leisten, wenn nicht Peterson mit seinen jugendlichen, jugendhaften Anhängern? Wer soll uns zur Ordnung rufen, wenn nicht der internationale YouTube-Traditionalist? Wer soll uns das Menschsein wieder näherbringen, wenn nicht der selbsterklärte Freund aller Krustentiere?
Es bleibt nur ein Kritikpunkt bezüglich zweier Auslassungen – oder Unterlassungen? – Petersons. Die erste betrifft den vor wenigen Jahren verstorbenen, französischen Theoretiker René Girard, mit dessen kreativ-katholischem Traditionalismus sich Petersons eigene Lesart insbesondere des Christentums eigentlich bestens verträgt. Girards Theorem der oft gewalttätigen Entladung mimetischer, also imitativer Begehrungs- und Handlungskreisläufe finden sogar in absentia eine gewisse Entsprechung in Petersons oft drastisch formulierten Ratschlägen bezüglich der Notwendigkeit, sich aus schädlichen sozialen Zusammenhängen zu lösen. (Ich weiß, was Sie jetzt denken. Zugegeben, es gibt schon genügend obskure, französische Theoretiker in Petersons Werk – aber: Girard ist längst kein Geheimtipp mehr. Vergessen Sie nicht, dass sein intelligentester Schüler der Milliardär Peter Thiel ist, der, üblicherweise eher kurz angebunden, gerne darüber plaudert, wie nützlich Girards Einsichten auch in der Welt des Geschäftemachens sind.)
Die zweite Auslassung ist etwas schwerer zu verzeihen. Es ist kein Zufall, dass ich bereits oben auf Leo Strauss verwiesen habe, den Kritiker der modernen Philosophie. Es gibt keinen Denker in der westlichen Tradition, der konsequentere Lehren aus den Totalitarismen des letzten Jahrhunderts gezogen hat als dieser vor den Nazis geflohene deutsch-jüdische Philosoph. Allein deshalb wäre er für Peterson interessant, der sich schließlich seit Jahrzehnten intensiv mit den Bedingungen und Auswirkungen von Faschismus und Kommunismus beschäftigt. Der Kanadier bezieht sich ausführlich auf die Psychologie der „Lebenslüge“, und es wäre einträglich, wenn er ihrer Genealogie bis in die Frühzeit der Moderne nachtastete, wie es der provokante Strauss einst tat, für den Machiavelli ein „Lehrer des Bösen“ gewesen war.
Beinahe dankbar für die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit
Darüber hinaus könnte eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Leo Strauss helfen, einen Defekt in Petersons Werk zu beheben. Zu stark setzt er gelegentlich (nicht immer) auf eine negative Grundauslegung des menschlichen Wertefelds, aus dem dann eine Handlungsmaxime für die entgegengesetzte Richtung abgeleitet wird. So schreibt er: „Jeder Mensch versteht a priori vielleicht nicht, was gut ist, aber sicherlich, was es nicht ist. Und wenn es etwas gibt, was nicht gut ist, dann gibt es etwas, das gut ist. Wenn die schlimmste Sünde die Folter anderer ist und zwar um des produzierten Leides willen – dann ist das Gute, was auch immer dem diametral entgegengesetzt ist. Das Gute ist, was auch immer solche Dinge davon abhält, zu geschehen.“
Aber das Leben ist nicht nur eine Reihe von Fehlern, denen es aus dem Weg zu gehen gilt. Strauss – der moderne Neuentdecker antiker Philosophie – wusste, dass es mehr gibt als das ledigliche Leben der Hobbes’schen Moderne. Es gibt Dinge und Taten, die es von sich aus wert sind, von uns erwählt zu werden. Dies ist die entscheidende Lektion des Aristoteles in seiner Nikomachischen Ethik. Aber auch die kommt in 12 Rules for Life leider nicht vor.
Jordan Peterson überzeugt mit seinen 12 Rules for Life fast auf ganzer Linie. Ohne die auch in Kanada wütenden Kulturkämpfe wäre er wohl nie in den Fokus einer größeren Öffentlichkeit gerückt – so ist man beinahe dankbar für die Irrungen und Wirrungen unserer Zeit. Was bleibt, ist Erleichterung darüber, dass ein so begabter Denker und Kommunikator wie Peterson auf der Seite der Ordnung steht. Man könnte ihm Glück für die Zukunft wünschen, aber das wird er nicht brauchen. Er ist ein Mann der gerechten Sache.
Den Blog von Moritz Mücke finden Sie hier. Dort kann er auch kontaktiert werden.